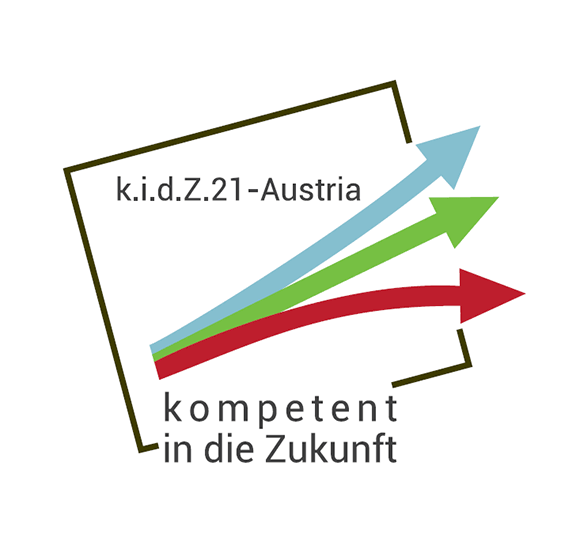Wo kann ich Gemüse beziehen, außer im Supermarkt?
Was passiert mit all dem zu großen oder zu kleinen Gemüse?
Warum werden so viele Lebensmittel weggeworfen?
Was mach ich mit altem Brot, damit es nicht im Müll landet?
Kann ich die Blätter von Radieschen wirklich essen?
Wie viel Ackerfläche verbrauche ich für mein Brot zum Frühstück?
Die derzeit weltweite Überbeanspruchung der Ressourcen und der Klimawandel sind in aller Munde, Auswirkungen sind bereits direkt erlebbar. Die Lebensmittelverschwendung (1/3 der weltweit produzierten Lebensmittel landen im Müll) hat einen gewichtigen Anteil an den enormen Folgen der Lebensmittelproduktion auf das Klima und die Umwelt. Im Rahmen der feld:Schule werden wir uns gemeinsam mit diesen Themen beschäftigen und die Wertschätzung für Lebensmittel steigern.
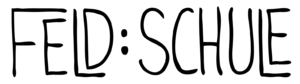
Unser Angebot
Das Angebot der feld:schule ist für die VS, MS und OS adaptiert. Die Module können einzeln oder, für eine vertiefende Auseinandersetzung mit dem Thema Lebensmittelwertschätzung, als mehrtägige Projekttage gebucht werden.
Die einzelnen Module finden entweder Indoor* oder Outdoor** statt.
Wir arbeiten mit Gruppen bis max. 25 Personen. Bei größeren Gruppen können wir die Angebote parallel 2x durchführen.
Indoor
Lebensmittelabfälle – Wie kommt es dazu? Warum sind sie ein Problem? Wir sammeln vielfältige Gründe, wie Lebensmittelabfälle entsteht und zeigen dessen negative Konsequenzen auf. Um etwas zu unternehmen formulieren wir gemeinsam Ideen zum Aktivwerden und zur konkreten Vermeidung von Lebensmittelabfall
Regionalität und Saisonalität sind wichtige Begriffe – aber welches Gemüse und Obst wächst eigentlich wann in der Region? Wo werden sie noch für uns angebaut? Und wo kommen die beliebten Lebensmittel ursprünglich her?
Der Weg der Lebensmittel nach der Ernte – vom Feld bis in den Handel – wird verfolgt und genauer betrachtet. Welcher Anteil der Ernte schafft es bis zum Verkauf? Welchen Einfluss hat der Mensch darauf? Wie bauen sich Preise auf?
Nach Absolvierung eines Sinnestrainings werden genießbare von nicht genießbaren
Lebensmitteln unterschieden und Grenzen und Möglichkeiten der Verwertbarkeit von Lebensmitteln erkundet.
Methoden des Konservierens und Haltbarmachens von Lebensmitteln stehen im
Mittelpunkt – theoretisch als Schatzsuche als auch praktisch durch die konkrete Umsetzung.
Ihr kennt bereits die Herausforderungen, die der Weltacker aufgreift? Jetzt geht es darum gemeinsam Lösungen zu finden, die darauf reagieren. Im Workshop suchen wir dem Lebensumfeld und Alter entsprechend Ideen. In begrenzter Zeit, utopische wie auch realistisch. Die Herausforderungen sind vielfältig – so auch unsere gemeinsam erarbeiteten Lösungsvorschläge.
Outdoor
Aus heutiger Sicht stehen weltweit jedem Menschen 2000 m² zur Verfügung, auf denen alles wachsen muss, was benötigt wird. Nur, was muss alles auf dem Weltacker Platz finden? Wie groß sind 2000 m²? Warum können wir nicht einfach mehr Acker bekommen? Mehr dazu auf der Seite des Weltackers Innsbruck.
Warum wird nicht alles gegessen, was auf den Äckern der Welt wächst? Wofür wird die Ernte sonst verwendet? In diesem Workshop wird der Fokus auf sogenannte „Non-Food“-Produkte gelegt. Am Beispiel Bioplastik, Tierfutter, Textilien und Biotreibstoff finden wir gemeinsam heraus, welche Pflanzen dafür angebaut werden und welche Konsequenzen das hat.
Kinder und Jugendlichen lernen bei einer Exkursion durch die Stadt alternative
Möglichkeiten zur Lebensmittelbeschaffung und Kriterien zur Kaufentscheidung kennen.
Auf dem Weltacker Innsbruck werden die Vielfalt, sowie essbare und nicht essbare Teile einer Pflanze erforscht. Zentral ist hier die Wertschätzung der Pflanze als Lebewesen und der gefährdeten / geförderten Vielfalt im Garten und am Feld.
*Indoor: Für diese Workshops kommen wir an die Schule – entweder in die Klasse, gerne aber auch in einen anderen Raum an der Schule.
**Outdoor: Für diese Workshops treffen wir uns entweder am Weltacker Innsbruck oder machen eine Exkursion durch Innsbruck. Nach Absprache können auch Exkursionen durch andere Städte oder Gemeinden organisiert werden.
Spezialangebot
Die Projekttage sind ein mehrteiliger Projektblock, der entweder an aufeinanderfolgenden Tagen oder auf einen längeren Zeitraum verteilt stattfinden kann. Hierfür können die einzelnen Module (max. 2 pro Tag) individuell zusammengestellt werden. Bedingung für die Projekttage ist der Besuch des Moduls „Der Weltacker und ich“ oder, sofern dieser bereits absolviert wurde, eines der Vertiefungsmodule am Weltacker
Kochtag:
Im Zuge der Projekttage bieten wir auch Kochtage für die VS und US an. Dazu kommen wir mit Rezepten und Lebensmittel in die Schulküche und kochen gemeinsam mit den SuS eine große Jause, die wir dann gemeinsam verköstigen. Der Unkostenbeitrag beträgt hier 2 Euro pro mitessender Person.
Beispiele für Projekttage
VS:
Tag 1 (2 UE): Die Zeit-Reise unserer Lebensmittel
Tag 2 (2 UE): Der Weltacker und ich
Tag 3 (2 UE): Essen nicht essen *neu*
Tag 4 (5 UE): Kochtag
US:
Tag 1 (2 UE): Der Weltacker und ich
Tag 2 (2 UE): MHD – mit Hirn degustieren
Tag 3 (3 UE): Lebensmittelbeschaffung in der Stadt
Tag 4 (2 UE): Weltacker-Vertiefung: Weltacker-Challenge *neu*
OS:
Tag 1 (2 UE): Lebensmittel – zu wertvoll um sie wegzuwerfen
Tag 2 (2 UE): Der Weltacker und ich
Tag 3 (2 UE): Weltacker-Vertiefung: Essen nicht essen *neu*
(16 UE für die OS)
Lebensmittelabfälle sind ein gravierendes Problem unserer Gesellschaft. Sie fallen in allen Bereichen der Lebensmittelnutzung an, so auch im gastronomischen Umfeld. Eine Auseinandersetzung mit dieser Thematik am Beginn der berufsbildenden Ausbildung stellt eine Chance dar, dieses Thema früh zu vermitteln und eine Integration in den Arbeitsalltag zu ermöglichen.
Lehrplanbezug & Kompetenzen
im Bereich Umweltbildung für nachhaltige Entwicklung
Unsere Herangehensweise zeichnet sich dadurch aus, dass wir durch
- sinnliche und spielerische Erfahrung,
- praktisches Tun und
- eigenständiges Arbeiten
gemeinsam:
- „Wissen aufbauen, reflektieren, weitergeben“,
- „eigene Meinung und Haltung entwickeln“,
- „bewerten, entscheiden, umsetzen“. (Auszüge aus Lehrplänen)
Dauer
Standard: 100 min = 2 UE
Optional: bis 200 min = 4 UE
Kosten



feld:Schule wird vom Amt der Tiroler Landesregierung Abteilung Umweltschutz zu 50% finanziell gefördert, vorausgesetzt die restlichen 50% (= 35,00 € / UE) werden vom Erhalter der Bildungseinrichtung getragen.
Die Stadt Innsbruck übernimmt für Innsbrucker Schulen (VS, MS) die restlichen 50%.
Die Agrarmarketing Tirol kann, in manchen Fällen nach Rücksprache mit uns, für Tiroler Schulen die restlichen 50% bzw. die Kosten für außerschulische Gruppen übernehmen.
Die Abrechnung erfolgt über die feld:schafft direkt mit den Fördergeber:innen.
Rückmeldungen von Lehrpersonen
„… Meine Erwartungen wurden um ein Vielfaches übertroffen…“
„…Es war beeindruckend, wie interessant, kindgerecht und kurzweilig die Inhalte vermittelt wurden.“
„…Wir werden das Thema immer wieder vertiefen, um im Sinne des Umweltschutzes etwas zu bewirken. Diese Veranstaltung hilft mir sehr dabei, danke!“
„…Wir danken dem Team von „die feld:schafft“ für ihre wertvolle Arbeit und empfehlen sie gerne weiter, weil sie einen großen Beitrag zur Erreichung der SDG ́s (Sustainable Development Goals) leisten und Bildung für nachhaltige Entwicklung voranbringen.“
„…Durch den Einsatz aller Sinne gelingt es der feld:schafft den Kindern die Wertschätzung für Lebensmittel näher zu bringen.“
„… Jedes Kind der Klasse wusste danach, um die vielfältigen Formen der Karotte Bescheid. Aber vor allem haben die Kinder erfahren, wie viele genießbare Lebensmittel weggeworfen werden, nur weil sie einer bestimmten Norm nicht entsprechen.“
Kontakt & Buchung
Falls Sie das Thema der Lebensmittelwertschätzung in Ihrem Unterricht einbinden möchten, kontaktieren Sie uns unter
Ursula 0676/7646693
Geschichte
Das Projekt feld:Schule wurde im Jahr 2016/2017 vom feld-Verein in Zusammenarbeit mit dem NEuEN Verein und einer Kooperation mit MUTTER ERDE entwickelt. Erstmalig wurden Exkursionen und Projektstunden für die Unterstufe (10-14 Jahre) ausgearbeitet und in einigen Schulen durchgeführt. In einem zweiten Schritt wurde das Projekt für Kinder von 7 bis 10 Jahren und einzelne Teile auch für die Oberstufe, Universität und Erwachsene adaptiert.